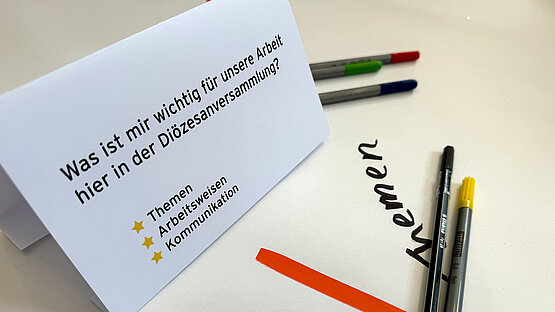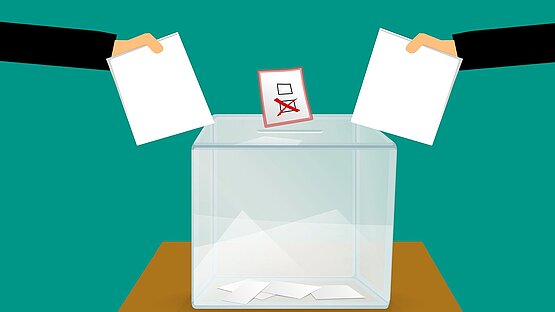Wir brauchen mehr Europa!


„Eine vielfältige, multinationale, auf Toleranz und gegenseitigem Respekt basierende europäische Gesellschaft ist keine Gefahr, sondern eine bereichernde Herausforderung. Eine Zusammenarbeit in Europa ist wichtig für unsere Zukunft“. Mit einem eindeutigen Plädoyer für ein starkes Europa hat die Limburger Diözesanversammlung am Samstag, 6. April, ihren Aufruf für die Wahl zum Europäischen Parlament verabschiedet. Er steht unter der Überschrift „Wir brauchen mehr Europa!“.
Die EU habe über Jahrzehnte Frieden, Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und wachsenden Wohlstand in Europa geschaffen. Dennoch gebe es eine lautstarke Gruppe von Europaskeptikern. „Sie wollen Europa schwächen oder gar das Europäische Parlament abschaffen. Das ist der falsche Weg! Wir meinen, dass es nicht weniger, sondern mehr europäische Zusammenarbeit braucht“, so die Limburger Diözesanversammlung. Nur ein starkes Europa könne sich den aktuellen weltpolitischen Herausforderungen wie Migration, Klimawandel, internationalen Wirtschaftsbeziehungen und Jugendarbeitslosigkeit stellen.
Kein Nationalismus und keine nationale Abschottung
Die gewählte Vertretung der Katholiken im Bistum Limburg verwehrte sich gegen Nationalismus und jede Politik der nationalen Abschottung. „Wir dürfen Europa nicht denen überlassen, die es zerstören wollen“, heißt es in dem Wahlaufruf. Deshalb gelte es, durch die Teilnahme an der Wahl zum Europäischen Parlament die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die europafreundlichen Parteien Vielfalt in Europa gewährleisten. Es gelte das Zusammenleben zu fördern, Kompromisse zu erarbeiten, Andersartigkeit zu tolerieren, religiöse Freiheit zu wahren, Fremden und Schwachen zu helfen und damit auch in Zukunft ein friedliches Zusammenleben, nicht nur in Europa, zu sichern. Dafür sei auch eine restriktive und europaweit praktizierte Rüstungsexport-Kontrolle unerlässlich.
Die Europawahl am 26. Mai sei eine Schicksalswahl. Es müsse Verantwortung übernommen und gemeinsam entschieden werden, in welchem Europa man leben wolle. „Deshalb nutzen auch Sie die Chance und wählen Sie: Gegen Populismus, Nationalismus und Angstmacherei – für ein starkes, friedliches und zukunftsorientiertes Europa“, so die Limburger Diözesanversammlung.
MHG-Studie und Aufklärung von sexuellem Missbrauch

Ein weiteres Mal hat sich die Limburger Diözesanversammlung auch mit der Aufarbeitung und dem Thema des sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen durch Kleriker in der katholischen Kirche befasst. Barbara Koepper von der Beratungsstelle „Gegen unseren Willen“ arbeitet seit Jahrzehnten mit Betroffenen zusammen und berichtete, welche Folgen sexueller Missbrauch haben kann. Opfer litten oft unter Angstgefühlen, Schlafstörungen und Albträumen. Es könne zu depressiven Reaktionen und Aggressionen kommen, zu Esstörungen, zu Schmerzen ohne organischen Befund, zum sozialen Rückzug und geringem Selbstwertgefühl, zu Verhaltensauffälligkeiten, Konzentrationsstörungen und Leistungsabfall und zu Suizidgedanken. „Eine Folge von sexuellem Missbrauch können körperliche, seelische und moralische Traumatisierungen sein“, erklärte Koepper. Häufig trete eine Überforderung ein und vorhandene Bewältigungsstrategien reichten dann nicht mehr aus. Im Gehirn entstünden dann Stressreaktionen und es komme zu einer Reizüberflutung der Sinne. „Jeder Mensch reagiert unterschiedlich“, so Koepper. Viele Opfer litten jedoch lebenslang an den Folgen des Missbrauchs.
Institutionelle Bedingungen

Einblicke in die MHG-Studie und auf institutionelle Bedingungen des sexuellen Missbrauchs von Kindern der katholischen Kirche als Organisation gab Professor Dr. Dieter Hermann den Mandatsträgern. Er ist Kriminologe und Mitglied des Kuratoriums der MHG-Studie. Für das Projekt sind mehr als 38.000 Personalakten der katholischen Kirche ausgewertet worden. Insgesamt fanden sich dort 1.600 Beschuldigte. „Beim Missbrauch Minderjähriger durch Kleriker handelt es sich nicht nur um das Fehlverhalten Einzelner. Das Augenmerk ist auf die spezifischen Strukturmerkmale der katholischen Kirche zu richten, die sexuellen Missbrauch Minderjähriger begünstigen“, so Hermann. Deshalb habe er in einer Studie alle relevanten Strafverfahren systematisch erfasst. Informationsquellen für die Studie seien die 116 Staatsanwaltschaften in Deutschland, die Generalvikare aller 27 Diözesen, Medienberichte und die Landes- und Staatsarchive gewesen. Diese Untersuchung habe zu interessanten Ergebnissen geführt. „Die Taten von Klerikern der katholischen Kirche sind ebenso schwer wie von Mitgliedern anderer Institutionen“, berichtete Hermann. Die in der katholischen Kirche zusätzlichen Normensysteme (Kirchenrecht, Zölibat, Christliche Religion) seien in Bezug auf den sexuellen Missbrauch Minderjähriger nicht handlungsrelevant. Die Normensysteme führten jedoch eher zu einem schlechten Gewissen und zu Reue. Mit Blick auf die Studie habe sich zudem gezeigt, dass Klerikalismus die Verharmlosung und Vertuschung von Vorwürfen gegen Kleriker fordert, weil sie als Gefährdung der Institution wahrgenommen würden. „Die katholische Kirche hat Vorwürfe gegen Kleriker in größerem Ausmaß verharmlost und vertuscht als andere Institutionen“, sagte der Kriminologe.
Umfangreiches Projekt zur Aufarbeitung im Bistum
Gegen Vertuschung, für Aufklärung und für die Umsetzung der Empfehlungen der MHG-Studie im Bistum Limburg setzt sich ein umfangreiches Projekt der Diözese ein, das auf Initiative des Diözesansynodalrates geplant und den Mandatsträgern von Dr. Wolfgang Pax, dem Bischofsvikar für die Synodalen Gremien, vorgestellt wurde. Mit dem Projekt leistet das Bistum einen Beitrag, damit Kinder und Jugendliche in der Diözese sicher leben und ihren Glauben entfalten können. Sexualisierte Gewalt an Kindern und Schutzbefohlenen verkehrt die christliche Botschaft in ihr Gegenteil und sei daher mit der Heilssendung der Kirche unvereinbar.
Die Aufarbeitung erfolgt im Bistum Limburg in insgesamt acht Teilprojekten (siehe Download): Neben einer bereits in Auftrag gegebenen unabhängigen Untersuchung aller Personalakten durch externe Fachleute will das Bistum die Aus- und Weiterbildung von Seelsorgern in der Diözese überarbeiten, deren Begleitung mit Personalführungskonzepten verbessern, sowie die Informationsabläufe innerhalb des Bistums und die Öffentlichkeitsarbeit des Bistums überprüfen. Darüber hinaus wird sich das Bistum mit den systemischen Faktoren, die Missbrauch in der katholischen Kirche begünstigen, beschäftigen: Klerikale Machtstrukturen müssten aufgebrochen, die Rolle der Frau in der Kirche gestärkt und die Auseinandersetzung mit der katholischen Sexualmoral forciert werden. In diesem Kontext soll auch eine Neubewertung von Homosexualität erfolgen. Zudem werden kirchenrechtliche Konsequenzen und eine Gewaltenteilung diskutiert. Nach der personellen Besetzung haben die Teilprojektgruppen bis Juni 2020 Zeit, konkrete Maßnahmen und Schritte zu entwickeln. Anschließend erfolgt die Umsetzung.